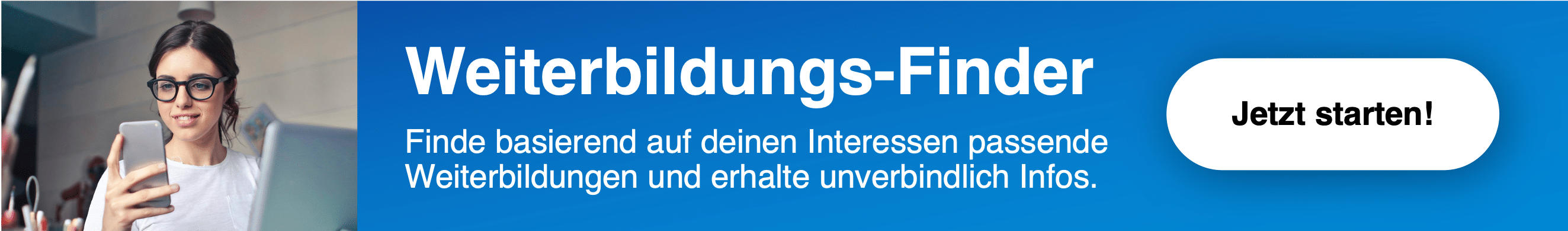A. ist Unistudentin und wusste schon früh, dass sie mit gewissen Dingen mehr Mühe hatte als andere Kinder. Hier erzählt sie uns von ihrem Weg, den sie seit dem Kindergarten mit ihrer Borderline-Symptomatik gegangen ist.
Die Studentin A.* lebt mit einer Symptomatik, die viel mit Borderline gemeinsam hat. Menschen, die von Borderline betroffen sind, hadern unter anderem mit emotionaler Instabilität, innerer Leere, intensiven, aber unbeständigen Beziehungen und Selbstschädigung, so die klinisch-diagnostischen Leitlinien der World Health Organization (WHO), wie sie Psychologen und Psychiater zur Diagnose verwenden. Als Störung von Charakter und Verhalten hat Borderline den Beginn in der Kindheit oder Jugend und zeigt sich in «persönlichen und sozialen Beeinträchtigungen». Wir haben A. ein paar Fragen zu ihrer individuellen Erfahrung mit ihrer Borderline-ähnlichen Symptomatik gestellt, und die Antworten geben uns einen Einblick in die Art, wie solche Umstände ein Leben beeinflussen können. Sie äussert sich ausserdem zur Wahrnehmung bzw. Stigmatisierung psychischer Störungen, die früher wie heute einem stetigen Wandel unterworfen ist.
Die World Health Organization verwendet in ihrer Klassifikation, genannt ICD-10, durchgehend den Begriff der Störung. Dies tun die Autoren deshalb, weil sie die problematischen Begriffe «Krankheit» oder «Erkrankung» vermeiden wollen. Der Störungsbegriff ist nicht exakt, konzentriert sich aber auf einen Komplex von Symptomen oder Verhaltensauffälligkeiten, die mit Belastung und Beeinträchtigung verbunden sind. Bei selbst Betroffenen gehen die Präferenzen für die Begriffe jedoch auseinander.
Eifersucht war bei mir immer schon ein grosses und auch belastendes Thema. Mir fällt es oft sehr schwer zu glauben, dass jemand, besonders mein Freund, mich wirklich liebt und mit mir zusammen sein will. Das führt häufig dazu, dass ich in anderen Frauen, welche in irgendeiner Weise Kontakt zu ihm haben und einigermassen attraktiv sind, eine Konkurrentin sehe. Das wiederum hatte zur Folge, dass ich oft ausrastete, wenn er sich mit Freundinnen traf oder ein Foto mit ihm und anderen Frauen irgendwo auf Social Media auftauchte. In solchen Momenten hat sich mein Bauch zusammengezogen, und am liebsten hätte ich mich übergeben. Gleichzeitig befand ich mich dann immer in einem Mix aus Trauer, Verzweiflung und Wut, und es fühlte sich an, als würde das, was ich gerade fühle, nie mehr aufhören. Meistens liess ich das direkt an meinem (heutigen) Freund aus und war unglaublich wütend auf ihn, dass er nicht nachvollziehen konnte, was solche Situationen in mir auslösen. Mein Freund entschuldigte sich zunächst immer und versuchte, mich zu beruhigen. Leider konnte ich das in den meisten Fällen nicht, oder zumindest nicht sofort, und schlussendlich kam es beinahe immer zu einem Streit, der wiederum dazu führte, dass ich mir selbst riesige Vorwürfe machte und wahnsinnige Angst bekam, dass mein Freund mich jetzt verlassen würde.
Meine Probleme fingen eigentlich schon im Kindergarten an, und ich ging deshalb bereits schon in sehr jungen Jahren in die Therapie. Allerdings hörte ich dann damit auf, da die Probleme besser wurden, als ich in einen anderen Kindergarten gewechselt hatte. Mit etwa 14 Jahren kamen die Probleme wieder zurück und wurden akut, als mein erster Freund mich mit etwa 16 Jahren verlassen hatte. Das führte dazu, dass ich mich wieder in Therapie begab. Mein erster Therapeut war allerdings keine grosse Hilfe, da er alles einfach auf die Pubertät schob und meinte, dass ich das jetzt einfach aushalten müsse. Als dann auch meine zweite Beziehung langsam in die Brüche ging, wechselte ich zu einer Psychiaterin, die mir aber nur Tabletten verschrieb und mir sonst auch nicht wirklich weiterhalf. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich alleine nichts wert wäre und dass mein Leben ohne eine Beziehung zu einem Mann keinen Sinn mehr machen würde. Dies führte zu selbstverletzendem Verhalten und Suizidgedanken. Das war selbstverständlich sehr schwer für meine Eltern, weswegen sie und mein Hausarzt schliesslich meinten, dass es vielleicht Sinn machen würde, einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik zu machen. Dort verbesserte sich mein Zustand schlagartig, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass mir jetzt geholfen wird und dass ich ernst genommen werde. Mein soziales Umfeld war dabei sehr unterstützend, wofür ich sehr dankbar bin. Noch während meiner Zeit in der Klinik lernte ich meinen jetzigen Freund kennen, der von Anfang an grosses Verständnis zeigte. Anfangs war unsere Beziehung leider auch geprägt von starken Verlustängsten und Eifersuchtsanfällen meinerseits, wie oben beschrieben. Doch irgendwie hat es gehalten. Es half dabei sehr, dass mein Freund mich beinahe dazu zwang, über meine Gefühle zu sprechen und sie ihm zu erklären, da das etwas war, was ich vorher nie gemacht hatte. Zudem habe ich endlich eine Psychologin gefunden, die mir wirklich helfen konnte und zu welcher ich jetzt auch seit über vier Jahren noch regelmässig gehe, wenn auch heute nur noch selten.
Heute habe ich meine Krankheit mehr oder weniger im Griff, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich gehe wie gesagt noch regelmässig in die Therapie und nehme auch nach wie vor Tabletten, die meine emotionale Stabilität wahrscheinlich fördern. Natürlich kommt es immer noch zu schwierigen Situationen, allerdings kann ich nun viel besser damit umgehen – auch ohne die Hilfe von anderen Personen – und falle nicht jedes Mal wieder in ein tiefes Loch. Zusätzlich fällt es mir heute durch meine Jahre an Erfahrung leichter zu unterscheiden, welche Gefühle «echt» und angemessen sind und welche ich mir mehr oder weniger einbilde. Auch die Beziehung zu meinem Freund ist stabil und nicht mehr überschattet von Verlustängsten. Ich glaube nicht, dass ich jemals ganz ohne psychische Probleme leben werde; ich glaube aber auch, dass das normal ist und dass jeder Mensch «sein Päckchen zu tragen hat». Es gibt immer noch Tage, an denen ich einfach aufwache und mich irgendwie leer und verzweifelt fühle. Aber wie gesagt: Ich weiss, dass es nun mal einfach zu mir gehört, dass ich mich so fühle. Ich weiss aber auch, dass es wieder vorbeigeht und dass es andere Tage gibt, an denen ich unbeschwert bin, und dass es Menschen gibt, die mir dabei helfen. Sie nimmt mich immer ernst, auch wenn ich Sachen erzähle, die für mich zwar sehr belastend sind, von aussen vielleicht aber eher banal klingen. Zudem versucht sie immer, mir eine andere Sichtweise auf meine Probleme zu vermitteln, was mir immer sehr hilft, da bei mir oft das Problem ist, dass ich gewisse Situationen falsch wahrnehme oder mich so hineinsteigere, dass ich oft gar nicht sehe, dass sie eigentlich nicht so dramatisch sind. Ausserdem habe ich einfach das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind, und mir hilft es auch, dass sie durch Familiengespräche und Gespräche mit meinem Freund mein engeres Umfeld einigermassen kennt. Dadurch glaube ich ihr auch viel eher, wenn sie mir zum Beispiel sagt, dass es jetzt irrational ist zu denken, dass mein Freund mich verlassen wird.
Mittlerweile beeinflusst meine Störung meine berufliche und akademische Leistung wirklich nur noch wenig. Anfangs war es schwieriger. Wenn mich etwas belastet hat, zum Beispiel ein Streit mit meinem Freund, konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren und fiel in ein absolutes Loch. Dadurch bin ich dann teils auch nicht in die Vorlesungen gegangen, oder es kam schon auch vor, dass ich heimlich bei der Arbeit weinte. Wenn so etwas dann noch kurz vor den Prüfungen vorkam, war das natürlich auch nicht gerade hilfreich, da ich mich meistens zusätzlich noch schlechter gefühlt habe, weil ich wusste, dass ich jetzt eigentlich lernen müsste. Im Allgemeinen hat es mir aber geholfen, zu arbeiten oder an die Uni zu gehen, weil ich dort meistens ein wenig abgelenkt war.
Wenn ich unsere moderne Schweizer Gesellschaft betrachte, denke ich, mittlerweile werden psychische Krankheiten weniger stigmatisiert. Betroffene reden jetzt offener darüber, und allgemein werden psychische Krankheiten in der Gesellschaft – zumindest in unserer – auch wirklich als Krankheiten anerkannt. Vor allem unsere Generation im Studentenalter erscheint mir viel offener, was das Thema anbelangt. Ich persönlich kann weniger aus Erfahrung sprechen, da ich allgemein ein Umfeld habe, das von Anfang an sehr tolerant war, was das Thema anbelangt. Ich hatte eigentlich auch nur Leuten konkret von meinen Problemen erzählt, die ich gut kannte.
Heute studiert A. Psychologie und arbeitet nebenbei im Service. Wenn auch du das Gefühl hast, dass dir deine psychischen Belastungen zu viel werden, findest du hier Hilfe:
An Universitäten
-Universität Zürich: Psychologische Beratungsstelle UZH/ETHZ, Plattenstrasse 28, 8032 Zürich, Tel. 044 634 22 80, Email pbs@sib.uzh.ch
-Universität Bern: Beratungsstelle der Berner Hochschulen, Erlachstrasse 17, CH-3012 Bern, Tel. 031 635 24 35, Email bernerhochschulen@erz.be.ch
-Universität Basel: Fakultät für Psychologie, psychologische Psychotherapie für Studierende, Missionsstrasse 62, 4055 Basel, Tel. 061 207 24 00, Email psychotherapie@unibas.ch
-Universität Luzern: Psychologische Beratungsstelle Campus Luzern, Museggstrasse 37, 6004 Luzern, Tel. 041 228 33 17 (Dr. Christine Seiger) oder Tel. 041 228 33 16 (M.Sc. Jonas Bamert), Email info@pblu.ch
Schweizweit
-Dargebotene Hand: 143 oder online
-Pro Juventute Beratung & Hilfe: 147 oder online
-Hilfe bei Suizidalität
Ich denke, nur schon die Tatsache, dass es zum Beispiel an der Uni, aber auch in vielen Betrieben, mittlerweile kostenlose psychologische Beratungsstellen gibt, die einen aktiv über Plakate oder Flyer dazu auffordern sich zu melden, wenn man Probleme hat, und darüber zu sprechen, ist für mich ein Zeichen, dass psychische Probleme kein Tabu mehr sein sollen. Es fällt einem heute wahrscheinlich immer noch nicht gleich leicht, zu sagen «Ich war heute beim Psychologen» wie «Ich war heute beim Zahnarzt», aber ich habe meistens nicht das Gefühl, dass Leute, die ich nicht so gut kenne, entsetzt reagieren oder aus einer Mücke einen Elefanten machen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich in die Therapie gehe.
Auch vonseiten Psychologen und Psychiater wird versucht, das Stigma ein wenig zu lösen, indem Diagnosen oft viel bedachter gestellt werden. Gerade bei Jugendlichen wie mir, die bereits eher früh in Behandlung gehen, wird oft gar keine endgültige Diagnose im Sinne von „Du hast jetzt XY“ gestellt, sondern oft wird einfach von einer Symptomatik gesprochen, die Züge aus gewissen Krankheitsbildern aufweist, und die wird dann behandelt. Das war auch bei mir der Fall. Ich denke, zum einen hilft es, wenn man weiss, was man hat, bzw. dass man etwas hat und sich das nicht einfach nur einbildet. Andererseits trägt man dann immer diesen Stempel, und es kann sein, dass man sich immer dahinter versteckt oder denkt, dass man nichts dagegen tun kann, weil man das Problem jetzt einfach hat. Deshalb wird heute meiner Meinung nach eher vorsichtig mit Diagnosestellungen umgegangen, auch um Patienten vor Selbst-Stigmatisierung zu schützen.
Eine eigene Erfahrung mit Stigma: Einige Wochen, bevor ich in die Klinik ging, stand ich mit ein paar Leuten an der Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits begonnen, mich immer öfter selbst zu verletzen. Allerdings habe ich das immer unter langer Kleidung versteckt, weswegen niemand in meiner Klasse davon wusste. Irgendwie sind wir dann auf das Thema zu sprechen gekommen und einer meiner Mitschüler hat genau das gesagt, was viele sagen: «Leute, die das machen, sind doch einfach nur dumm und wollen Aufmerksamkeit». Natürlich hat er das nicht direkt zu mir gesagt oder es auf mich bezogen, weil er ja auch nicht wusste, dass ich davon betroffen bin, aber es hat mich in diesem Moment doch sehr getroffen.
Eine besonders gute Situation war, als ich die Mutter meines Freundes kennenlernte. Er hatte ihr vorher ganz offen erzählt, dass ich in einer Klinik war und psychische Probleme hatte. Sie sprach mich dann gleich am Anfang ganz offen darauf an, was mir zunächst etwas unangenehm war. Ich merkte aber gleich, dass sie wirklich damit umging, als hätte ich ein gebrochenes Bein gehab. Sie geht auch nach wie vor überhaupt nicht wertend mit dem ganzen Thema um, sondern zeigt einfach nur ehrliches Interesse, was es mir dann wiederum einfacher macht, selber offen darüber zu sprechen.
*Name der Redaktion bekannt
Quelle ICD-10: Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M.H. (Hg.) (2014). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern: Verlag Hans Huber.