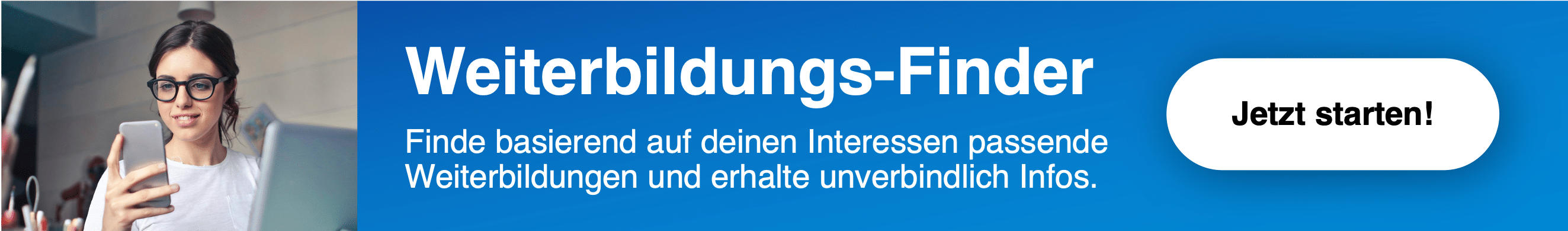Ueli Mäder, emeritierter Professor für Soziologie in Basel und Aktivist der 68er, setzt sich auch heute noch mit der Schnittstelle zwischen Bildung und Wirtschaft auseinander. Ein Interview zu ökonomischem Nützlichkeitsdenken, unabhängiger Bildung und Chancengleichheit.
Wer behauptet, dass nur in den Sechzigern für bessere Bildung protestiert wurde? Im März dieses Jahr fand die schweizweite Aktionswoche «Bildungsaufstand» statt, bei der in Basel eine organisierte Demonstration gegen die Abbaupolitik in der Bildung und für eine freie, starke und emanzipatorische Bildung stattfand. Dabei war unter anderem Prof. em. Ueli Mäder mit seinem Vortrag zur «Ökonomisierung der Bildung» zu Gast. Kurz darauf veröffentlichte SRF Interviews zum Thema Hochschulfinanzierung mit Herrn Mäder und Michael Hengartner, dem Rektor der Universität Zürich, im Sinne der Aktionswoche. Im Video äusserte sich Mäder kritisch zur Beziehung zwischen Universitäten und Spendengeldern durch Private. Es komme vor, so Mäder, dass Forschung auf diese Weise in bestimmte Richtungen gelenkt würde und dies stehe einer innovativen Forschungskultur im Weg. Uns interessierte an Herrn Mäders Arbeiten, wie sich diese Problematiken auf die Auszubildenden selbst auswirken. Im Interview gibt er Auskunft.
«Die Ökonomisierung betrifft vornehmlich Hochschulen und die Forschung.»
Herr Mäder, Sie haben im März an der Uni Basel ein Referat zum Thema «Ökonomisierung der Bildung» gehalten. Was sind für Sie Beispiele einer solchen Ökonomisierung?
In einer universitären Weiterbildungskommission diskutierten wir einmal den Antrag eines Wirtschaftsprofessors. Er wollte das Tageshonorar der Dozierenden auf 4‘000 Franken anheben und nach oben flexibilisieren. So liessen sich die besten Leute anlocken und dann die Studiengebühren entsprechend anheben, lautete seine Begründung. Die Uni-Leitung kam ihm mit einem Kompromiss entgegen, denn sie muss die Weiterbildung von Dozierenden rentabler gestalten. Das verlangen schliesslich auch die politischen Vorgaben, die sich inhaltlich auf Stoff und Umfang der Weiterbildungsangebote auswirken.
Welche Bereiche der Bildung sind Ihrer Meinung nach besonders von einer Ökonomisierung betroffen?
Die Ökonomisierung betrifft vornehmlich Hochschulen und die Forschung. Sie orientiert sich an unmittelbarer Nützlichkeit und setzt Mittel dort ein, wo sie sich optimaler verwerten lassen. Höhere Ausbildungen favorisieren entsprechend marktkonforme Abschlüsse, da diese die aktuelle Nachfrage bedienen. Beispiele sind insbesondere Fachkräfte aus den MINT-Fachbereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) oder Kader aus dem Wirtschaftssektor. Das verschulte Lernen und die bürokratische Mentalität dieser Bildungsbereiche beeinträchtigen das eigenständige, innovative Denken. Hochschulen müssen zudem immer mehr private Mittel anheuern. Sie achten auch bei der Besetzung von Professuren darauf, wer wie viele Drittmittel mitbringt oder einwerben kann.
Wenn Sie diese Bildungsbereiche betrachten, was sind die Auswirkungen für die Auszubildenden?
Studierende orientieren sich pragmatisch an Kreditpunkten, tun, was man ihnen vorgibt, und verlieren an der intrinsischen Motivation, eine komplexe Materie frei gewählt zu durchdringen. Das zweckrationale Denken übernimmt die technische Logik, die die Studierenden kontrollieren sollte. Ein Beispiel dafür findet man bei Studierenden der Psychologie: Multiple-Choice-Prüfungen, mit denen man sich Credits verdienen kann, sind häufig. Entsprechend lernen die Studierenden vornehmlich die Inhalte, von denen sie annehmen, dass sie abgefragt werden könnten. Dabei kommt die Orientierung an theoretischen Bezügen und einer erweiterten Berufspraxis zu kurz, sei das in Psychotherapie, Forschung, HR oder anderem. Damit erhöhen wir die Gefahr, Probleme mit ähnlichen Mitteln lösen zu wollen, die sie verursachen, wie hier mit einer übermässigen Standardisierung des Prüfungswesens.
Worin sehen Sie die Wurzel der Ökonomisierungsbewegung innerhalb des Bildungswesens?
Seit Ende der 80er-Jahre überlagert ein finanzgetriebenes Verständnis der Bildung das politisch-liberale, das einen sozialen Ausgleich förderte. Heute dominiert ein Gelddenken, das alle Lebensbereiche und auch die Bildung durchdringt.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial für das Schweizer Bildungssystem, und wo dürfen wir zufrieden sein?
Die Schweiz tut viel für die Bildung; das ist von hohem Wert. Früher herrschte eine borniert- defizitorientierte Pädagogik mit alten Reiz-Reaktions-Modellen von Schülerverhalten. Diese wichen kognitiven Modellen, deren Umsetzung die Kompetenzen stärken. Die Ökonomisierung gefährdet diese Erfolge; da kommt ein Input-Output-Drive auf, der die Horizonte eher verengt, denn weiter öffnet. Wichtig sind Prozesse der sozialen Teilhabe und der demokratischen Mitbestimmung in allen Bildungsbereichen, wo eine Anknüpfung an erkämpfte Errungenschaften möglich wird. Zudem gilt es, die gewiss bedeutenden wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen mit gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen zu verbinden. Philosophie, Musik und Literatur fördern die Kreativität und schärfen unsere Sensibilität für das, was sinnvoll und human ist.
«Das Anheben von Studiengebühren ist ein Schritt in die falsche Richtung. Als liberaler Sozialist würde ich die Gebühren tief halten.»
Ist für junge Menschen in der Schweiz ein chancengleicher Bildungsweg gegeben?
Der Zugang zur Bildung hat sich für Frauen stark verbessert, was erfreulich ist. Leider setzen sich aber soziale Ungleichheiten immer noch fort. Kinder von reichen Eltern mit einem akademischen Abschluss haben eine viel höhere Chance, eine qualifizierte Ausbildung zu erlangen. Wenn wir da Ungleiches einfach gleich behandeln, bleibt es ungleich.
Was kann die Politik, was können Aktivisten hierbei leisten?
Die Politik muss die schulische und berufliche Bildung weiter stärken, ebenso die unabhängige Forschung. Kinder aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien benötigen vor allem beim Einstieg in das Bildungssystem viel Beachtung und Verständnis. Zentral ist generell die Freude am eigenen Entdecken, was sich auch im beruflichen Leben zeigt. Wer anerkannt und gefragt ist, übernimmt gerne Verantwortung.
Tatsächlich sind ja in den letzten Jahren die Studiengebühren an Schweizer Universitäten angestiegen. Würden Sie als liberaler Denker gleich eine Abschaffung der Studiengebühren befürworten, wie das bereits in öffentlichen Universitäten in Norwegen der Fall ist?
Das Anheben von Studiengebühren ist ein Schritt in die falsche Richtung. Als liberaler Sozialist würde ich die Gebühren tief halten. Ein Franken pro Tag könnte eine symbolische Geste sein und an die staatlichen Aufwendungen erinnern. Wichtig dünkt mich dabei, dass Studierende ganz verschiedene Lebensbereiche sinnlich wahrnehmen und sich aus freien Stücken sozial engagieren. Wer sich zum Beispiel für Menschen mit einer Beeinträchtigung einsetzt, erfährt andere Realitäten und steht anders im Leben. Das wäre ein wichtiger Beitrag vonseiten der Studierenden.
Um das Thema zu wechseln: Bei Ihrer Arbeit als Soziologe haben Sie sich vielleicht auch schon mit dem Thema der fortschreitenden Digitalisierung befasst. Wie haben Sie diesen Fortschritt in Bezug auf das Bildungswesen erlebt?
Bei meinen Recherchen, der Dokumentation und Kommunikation erlebe ich die Digitalisierung als hilfreich. Ich kann mich so mehr auf Inhaltliches konzentrieren. Aber die einfach zugängliche Information ist selektiv aufbereitet, und beim Abholen dieser Informationen gebe ich auch Persönliches preis. Das wirft Fragen auf: Was geschieht mit diesen Daten? Wie prägt uns die digitale Logik mit ihrer mechanischen Funktionalität? Wer kontrolliert die künstliche Intelligenz? Und wer profitiert von den Produktivitätsgewinnen? Wir müssen das Digitalisieren demokratisieren und einseitige Abhängigkeiten verhindern. Wir müssen uns intensiv über gesetzte und notwendige Grenzen verständigen und nicht alles tun, was wir auch tun können. Vielleicht kommen wir zum Beispiel bald dazu, einzelne Arbeitsbereiche wieder bewusst personalintensiver zu gestalten, die robotisierte Beratung bei Banken rückgängig zu machen und kleine Bahnhöfe wieder zu besetzen.
Und schliesslich: Was für Vorschläge zu Aus- und Weiterbildung würden Sie heute einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, der in den Arbeitsmarkt eintreten möchte?
Ich empfehle ihm, das anzustreben und zu pflegen, was ihn am meisten interessiert.
Ueli Mäder ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel und Alt-Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät. Er leitete das Seminar für Soziologie und lehrte auch an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Von ihm ist dieses Jahr das Buch „68 – was bleibt?“ (rpv, Zürich 2018) erschienen.